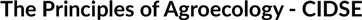2. Die soziale und kulturelle Dimension von Agrarökologie
2.1 Agrarökologie wurzelt in der Kultur, Identität, Tradition, Innovation und dem Wissen lokaler Gemeinschaften
2.2 Agrarökologie trägt zu einer gesunden, vielfältigen und saisonal sowie kulturell angepassten Ernährung bei.
2.3 Agrarökologie ist wissensintensiv und fördert Vernetzung und horizontalen Austausch von Wissen, Fertigkeiten und Innovationen, wobei auch Allianzen entstehen, in deren Rahmen Bauern und Bäuerinnen mit Wissenschaftler*innen auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
2.4 Agrarökologie schafft und fördert Gelegenheiten zur Solidarität und Austausch zwischen und innerhalb kulturell unterschiedlicher Gruppen (z. B. verschiedene Ethnien mit ähnlichen Werten, aber unterschiedlichen Herangehensweisen) und zwischen Menschen auf dem Land und in der Stadt.
2.5 Agrarökologie respektiert die Vielfalt der Menschen im Hinblick auf Geschlecht, Abstammung, soziale Orientierung und Religion, schafft Chancen für junge Menschen und Frauen, ermutigt Frauen, eine führende Rolle einzunehmen, und fördert die Gleichberechtigung von Mann und Frau.
2.6 Agrarökologie erfordert nicht notwendigerweise eine kostspielige externe Zertifizierung, da es oftmals um das Verhältnis zwischen Produzent*innen und Verbraucher*innen geht und um das gegenseitige Vertrauen, wodurch Alternativen zur Zertifizierung entstehen – etwa in Form partizipativer Garantiesysteme (PGS) und solidarischer Landwirtschaft (SoLaWi).
2.7 Agrarökologie unterstützt Menschen und Gemeinschaften, ihre spirituelle und materielle Beziehung zu ihrem Land und ihrer Umgebung zu bewahren.
Auswirkung dieser Dimension
Ausgangspunkt ist das Vorwissen, die Fähigkeiten und Überlieferungen von denjenigen, die Landwirtschaft betreiben und Lebensmittel erzeugen. Deshalb ist Agrarökologie besonders gut geeignet, das Recht dieser Menschen auf Nahrung zu sichern. Agrarökologie ermöglicht die Entwicklung angepasster Technologien, die zugeschnitten sind auf die spezifischen Bedürfnisse und Lebensumstände kleinbäuerlicher Gemeinschaften, Landloser, Indigener, Nomadenvölker oder Gemeinschaften, die vom Fischfang, ihren Herden oder von der Jagd und dem Sammeln von Lebensmitteln leben. In den meisten Entwicklungsländern ist die Landwirtschaft nach wie vor der Haupterwerbszweig, so dass diese Branche die besten Chancen für eine inklusive Entwicklung bietet. Damit kann ein Beitrag geleistet werden, um der Landflucht und dem Auseinanderbrechen von Familien Einhalt zu bieten. Wenn die Menschen agrarökologische Praktiken erlernen und anwenden und die Wertschöpfung bis zu den Endverbraucher*innen beeinflussen können, wird das Leben auf dem Land und die Erzeugung von Nahrungsmitteln (in einem ländlichen oder städtischen Umfeld) wieder attraktiver und gesellschaftlich anerkannt. Die Folge ist eine florierende lokale Wirtschaft, sozialer Zusammenhalt und Stabilität.
Indem diejenigen, die Nahrungsmittel erzeugen, (durch den Austausch über nützliche Praktiken, Schulungen usw.) ins Zentrum der Ernährungssysteme gestellt werden und die Autonomie und Wiederbelebung ländlicher Gebiete gefördert werden, trägt Agrarökologie dazu bei, der kleinbäuerlichen Identität einen neuen Wert zu geben, das Selbstvertrauen zu stärken und zur aktiven Beteiligung an lokalen Ernährungssystemen anzuregen.
Indem Produzent*innen und Verbraucher*innen durch kürzere, lokale Wertschöpfungsketten enger zusammengebracht werden und die Rolle und Mitsprache beider Gruppen gestärkt werden, leistet Agrarökologie einen Beitrag um Ernährungssysteme gerechter zu gestalten und von der Macht der Konzerne abzukoppeln.
Lynn Davis, La Via Campesina (UK)
Krinshnakar Kumari, MIJARC (India)
Solidarität und Vertrauen im Verhältnis zwischen Hersteller*innen und Konsument*innen werden gestärkt und es ist dafür gesorgt, dass beide Gruppen nahrhafte, gesunde und kulturell angepasste Nahrungsmittel zur Verfügung haben. Die Vielfalt an Lebensmitteln vor Ort wird unterstützt, was dazu beiträgt, kulturelle Identitäten zu bewahren. Ein höherer Anteil an Direktverkäufen verbessert überdies die CO2-Bilanz des Ernährungssystems und verringert die Umweltbelastung durch weniger Verarbeitung, Verpackung und kürzere Transportwege.
Agrarökologie schafft Chancen für Frauen, ihre wirtschaftliche Autonomie zu verbessern und bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf bestehende Machtverhältnisse zu nehmen, auch im häuslichen Umfeld. Dabei steht auch den Männern eine größere Vielfalt an Rollen und Wertschätzung offen. Agrarökologie als Bewegung ist inklusiv und tritt daher für Frauenrechte ein: die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft wird anerkannt und gefördert und Frauen werden dazu ermutigt, sich aktiv einzubringen. Da es im Grunde um einen Kampf für soziale Gerechtigkeit und Emanzipation geht, sollte die agrarökologische Bewegung immer auch den Feminismus mit berücksichtigen. Weil aber Agrarökologie das Geschlechterverhältnis nicht automatisch positiv beeinflusst, ist es nötig, bei der Umsetzung der Agrarökologie mit den verschiedenen Dimensionen stets die Frauen besonders im Blick zu haben.
Beispiel 1: Zugang zu Land und Agrarökologie: ein Beitrag zur Stärkung von Frauen in Indien
Sozialer Wandel und die Stärkung der Rolle der Frau sind wesentliche Elemente der Agrarökologie. Eine kürzlich im indischen Maharashtra durchgeführte Studie, bei der 400 kleinbäuerliche Haushalte interviewt wurden, zeigt auf, wie Frauen eine nachhaltige und diversifizierte Lebensmittelproduktion in Gang gesetzt haben, nachdem sie Zugang zu Land bekommen hatten. Im Untersuchungsgebiet hatten Frauen sehr geringe Entscheidungsbefugnisse in der Landwirtschaft. Im Rahmen des sogenannten „Ein-Acre-Modells“ wurden Frauen dazu aufgerufen, von ihren Männern ein eigenes Stück Land zur Bewirtschaftung einzufordern. Auf diesen Feldern bauten sie verschiedene Feldfrüchte an (Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse). Mithilfe von Praktiken wie dem Mischanbau vergrößerten sie die Erntevielfalt; durch die Nutzung von Dung, Kompost und organischen Abfällen reduzierten sie den Einsatz von Kunstdünger, auch bauten sie weniger Cash Crops (Zuckerrohr, Sojabohnen) an, um die Ernährungssicherheit und die Ressourceneffizienz beim Wasserverbrauch zu verbessern. Das war bedeutsam, weil die Region eine der schlimmsten Dürren seit 75 Jahren durchmachte.
Die Studie zeigte, dass wegen dieser positiven Veränderungen im Hinblick auf die Geschlechterrollen, und weil mehr Lebensmittel zur Verfügung standen, Mädchen und Frauen mehr und gesünderes Essen zu sich nehmen konnten. Die im Rahmen der Studie Befragten ließen keinen Zweifel daran, dass Qualität und Frische der Nahrungsmittel deutlich zugenommen hatten und sich in der Folge der Gesundheitszustand der gesamten Familie gebessert hatte. Der Wert der zu Hause verzehrten Speisen war 67 % höher im Vergleich zur Kontrollgruppe, die sich auf den Anbau von Cash Crops konzentriert hatte. Wird der Wert des konsumierten Essens auf das Bruttogesamteinkommen der Haushalte angerechnet, zeigt sich, dass der agrarökologische Ansatz einen positiven Einfluss auf die bäuerlichen Haushaltseinkommen hatte. Das war insbesondere vor dem Hintergrund der Dürre bedeutsam, welche ärmere Haushalte tief in die Verschuldung trieb.
Darüber hinaus belegte die Studie, dass durch diesen Ansatz die meisten Frauen die Möglichkeit bekamen, über das Land, den Anbau und sogar die Vermarktung der Produkte zu bestimmen. Neben dem Zugang zu Land war die Beteiligung der Frauen an Führungskursen und Frauengruppen ausschlaggebend. Fast ein Viertel der Frauen wurde selbst zu Ausbilderinnen und Anführerinnen, um das Wissen über agrarökologische Anbaumethoden, landwirtschaftliche Betriebsführung und Vertrieb mit anderen zu teilen.
Bei der sozialen und kulturellen Dimension von Agrarökologie geht es unbedingt auch um Rollen und den Versuch, gleichberechtigte Beziehungen auf allen Ebenen des Ernährungssystems anzustreben und zu unterstützen. Das Beispiel zeigt, wie Agrarökologie durch eine Genderausrichtung und die Berücksichtigung von Frauen zu ihrer Stärkung beitragen kann.
Quellen/weiterführende Informationen
Bachmann, Lorenz, Gonçalves, André, Nandul, Phanipriya (2017). Empowering women farmers’ for promoting resilient farming systems. Sustainable pathways for better food systems in India.